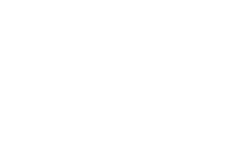Beitrag aus dem IBA’27-Kuratorium
Ein neuer Zeitgeist
von Thomas Auer
Von der Offenheit der Moderne zur technischen Abhängigkeit
Licht, Luft und Sonne war der Slogan der Moderne, geprägt von Transparenz und Offenheit. Zu Beginn war die Moderne geprägt von einer Architektur die passive Ansätze, wie Wintergärten, Temperaturzonen, natürliche Lüftung, etc. nutze. Eine Ikone aus dieser Zeit ist das Queen Alexandra Sanatorium in Davos von den Schweizer Architekten Pfleghard und Haefeli und des renommierten Bauingenieurs Robert Maillart. Als Ergebnis der integralen Arbeit von Ingenieur, Architekt und jungen Medizinern entstand eine neue Art der Architektur. Von entscheidender Bedeutung war die Verbindung von Innen- und Außenraum. Dies hat sich in der Weißenhofsiedlung in Stuttgart fortgesetzt. Erst in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts hat man begonnen Gebäude – vor allem im Nichtwohnungsbau – hermetisch abzuriegeln, um das Klima und vermeintlich auch den Energieverbrauch zu kontrollieren. Die Gebäudehülle wurde plötzlich im Fassaden-Engineering als »Line of Defense« bezeichnet. Die Entwicklung war sicherlich getrieben von der Technikgläubigkeit der Nachkriegszeit. Es begann der internationale Siegeszug der Air-Conditioning und der Glasrchitektur, mit der man bis heute Fortschritt und Prosperität zum Ausdruck bringen möchte.
Der globale Siegeszug der Klimatisierung
Die Erfindung der Air-Conditioning in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hat es ermöglicht diesen Ansatz einer gläsernen Architektur auf nahezu alle Gebäude – unabhängig von der Nutzung, der Skalierung oder dem lokalen Klima – zu übertragen. Es entstand ein globaler Trend, der auf die Verfügbarkeit von billiger Energie und anderen Ressourcen baute. Auf der ganzen Welt entstanden Hochhäuser aus Beton, Stahl und Glas. Hinzu gesellte sich eine »because we can« Haltung. Es wurden Gebäude gebaut die vermeintlich der Physik trotzen, die höchsten Wolkenkratzer, das schlankeste Hochhaus, etc. Das Ganze gipfelt in einem 90 Kilometer langen und bis zu 500 Meter hohen, verspiegelten Hochhaus, das in der Wüste Saudi-Arabiens geplant ist. All dies befeuert den Bedarf an Energie und Ressourcen. Die internationale Energieagentur berichtet, dass in 2024 der weltweite Energiebedarf um zwei Prozent angestiegen ist und die Hälfte davon auf Klimatisierung zurückzuführen ist [1]. Dies entspricht dem Trend, nachdem die Anzahl der weltweit installierten Klimageräte exponentiell ansteigt.
Ein neuer architektonischer Zeitgeist
In Anbetracht der globalen Herausforderung braucht es zwingend eine Umkehr. Diese wird in Deutschland oft als Bauwende bezeichnet. Weltweit versucht man den enormen Ressourcenbedarf des Gebäudesektors mit Regulierung in den Griff zu bekommen, was nur leidlich gelingt. Häufig treibt die Regulierung seltsame Blüten. Wir ringen in Deutschland um jeden cm Wärmedämmung an Wohngebäuden, während wir problemlos ein spekulativ getriebenes, gläsernes Hochhaus, ohne außenliegender Verschattungseinrichtung und ohne öffenbaren Fenstern, mit zahlreichen Untergeschossen bauen dürfen. Das Gebäude kann problemlos, sofern dies erwünscht ist, ganzjährig auf 22 Grad Celsius klimatisiert werden.
Natürlich braucht es Regulierung und natürlich erfreuen wir uns an der Normierung der Steckdose, die es uns ermöglicht in ganz Europa das Handy zu laden. Gleichzeitig haben wir mit den knapp 4.000 allgemein anerkannten Regeln der Technik ein Dickicht geschaffen, in dem wir uns zwangsläufig verlieren müssen. Das Beispiel des Hochhauses führt uns vor Augen, dass sich nicht alles regulieren lässt. Mächtiger und wirkungsvoller als Regeln ist (hoffentlich) ein neuer Zeitgeist (auf Neudeutsch eine »bottom-up« Bewegung). Dieser Zeitgeist zeichnet sich dadurch aus, dass eine angemessene Aufenthaltsqualität mit Mitteln der Architektur und möglichst wenig Technik erzielt wird. Der Einsatz natürlicher Materialien und die Vermeidung physikalischer «Verrenkungen» sind weitere Aspekte, wie euch ein menschlicher Maßstab, das Verständnis von Form und Raum, der haptischen als auch ökologisch und physikalischen Wirkung von Material.
Dieser neue Zeitgeist ist in Ansätzen bereits weltweit zu erkennen und breitet sich aus. Es scheint, als ob mehr und mehr Bauschaffende, aber auch die Bevölkerung im Allgemeinen, dieser identitätslosen, ressourcenvernichtenden Architektur überdrüssig ist. Es entsteht eine neue Architektursprache, ohne dass diese gleich zu einem neuen »ismus«, wie Konstruktivismus oder Modernismus, verklärt werden muss. Es geht nicht um eine Überhöhung, sondern oftmals um gesunden Menschenverstand. Dabei entsteht im Idealfall eine Architektur, die poetisch und zukunftsorientiert ist. Das bedeutet nicht »back to the future«. Man kann und sollte von der traditionellen Architektur lernen, aber Architektur muss auch immer ein Versprechen für eine bessere Zukunft sein, was eine Kopie der Vergangenheit per se ausschließt.
In diesem Zeitgeist entstehen Gebäude auf der ganzen Welt. Dabei kommen Biogene Baustoffe, wie Holz, Stroh oder Algen zum Einsatz, genauso wie mineralische Baustoffe wie z.B. Lehm (als Stampflehm, Lehmstein, Platten, Lehmputz, etc.) oder Naturstein. Bauen im Bestand bzw. die Wiederverwendung von Baustoffen oder ganzen Bauteilen hat die letzten Jahre an Popularität gewonnen. Auch der Baustoff Naturstein erfährt gerade eine Renaissance. Es entsteht eine Architektur, die nicht durch Glas geprägt ist und eine Formensprache, die dem Material gerecht wird. In der konventionellen Bauweise wird eine mineralische Geschossdecke (z.B. Beton) mit viel Stahl und mehr Beton als notwendig in eine flache Form gezwungen, wohl wissend, dass für eine traditionelle Kappendecke nur etwa die Hälfte des Materials aufgewendet werden muss.
Mit dieser Haltung entwerfen Büros wie TEd’A Arquitectes aus Spanien Wohnungsbau und Schulen, die selbst im spanischen Klima ohne Klimatisierung auskommen. Roswag & Janowski Architekten zeigen mit ihrer Torfremise für Wohnen und Arbeiten wie man konsequent und durchaus kostengünstige Gebäude mit natürlichen Materialien realisieren kann. Das gleiche gilt für Florian Nagler Architekten und dem von ihm entworfenen Gartenhaus in der Theodor-Storm-Str. in München, das komplett ohne Zement realisiert wurde.




Manchmal hilft der Blick von außen um die IBA’27 der Region Stuttgart einzuordnen. Die IBA kam in eine wirtschaftlich schwierige Zeit, die den Bausektor in den letzten Jahren nahezu zum Erliegen brachte. Trotz der Widrigkeiten entstehen spannende und geradezu wegweisende Gebäude. Die IBA’27 hat es geschafft die ganze Region einzubeziehen. Es entstehen zahlreiche Gebäude in diesem neuen Zeitgeist. Es entsteht kein Eifelturm und kein Architekturzoo auf einem eingezäunten Gelände. Vielmehr findet das »neue Bauen« in der Region statt. Es entsteht mehrgeschossiger Wohnungsbau bzw. Gebäude mit gemischter Nutzung, gebaut mit Materialien wie Holz, Lehm und Stroh. Solche Projekte entstehen in einem Kontext, in dem im Neubau bisher nahezu ausschließlich in Einfamilienhausgebieten gedacht wurde. Anstatt einer Tiefgarage aus Beton entstehen Quartiersgaragen aus Holz. Diese helfen das Quartier zu beleben, da die Bewohner über den öffentlichen Raum nach Hause laufen, anstatt aus der Tiefgarage den Aufzug zu nehmen. Mit der Quartiersgarage geht die Hoffnung einher, dass die Anzahl der PKWs irgendwann abnehmen wird und die Garage für andere Nutzungen adaptiert werden kann.
Die Zukunft zeigt sich in Orten wie Backnang, Korb, Mühlhausen, Roth, etc. Dies ist logisch und folgerichtig, da ca. 70 Prozent der Einwohner Deutschlands nicht in Großstädten leben. Die Projekte adressieren die Themen der Nachhaltigkeit rund um wohnen, arbeiten und Mobilität. Es geht um die Grundbedürfnisse der Menschen und um das gesellschaftliche Zusammenleben und wie wir all dies mit den beschriebenen Ansätzen materialisieren.
Wie die IBA’27 den Wandel sichtbar macht
Es ist genau der Zeitgeist, den diese IBA befeuert und damit einen wichtigen Beitrag leistet. Diese Veränderung des Bauens macht auch vor einem spekulativen Bürogebäude nicht halt. So ist in Stuttgart-Möhringen das Bürogebäude Zero. [2] entstanden. Das Gebäude mit ca. 10.000 Quadratmeter von Riehle Koeth Architekten ist aus Holz gebaut. Den Nachteil eines »schlechteren« sommerlichen Wärmeschutzes der leichten Bauweise begegnet das Gebäude mit einem innovativen, ausgeklügelten Energiekonzept. Dieses zielt auf einen nachhaltigen und robusten Gebäudebetrieb mit angemessenen Komfortbedingungen. Das Raumprogramm, die Belegung, sowie die Flexibilität hinsichtlich der Teilbarkeit der Flächen ist auf die Ziele des Klimakonzeptes abgestimmt. Damit konnte auf aufwendige Verteil- und Klimaregelsysteme verzichtet werden. Mittels Fassadenlüftungselemente mit nachgeschalteter Vorheizung und Kühlung wird die Zuluft der Büroflächen vorkonditioniert. Mithilfe von Abluftkaminen und den Lüftungselementen in der Fassade, können die Bürogeschosse überwiegend natürlich gelüftet werden. Deckenventilatoren unterstützen die Luftverteilung im Gebäude und verbessern den thermischen Komfort im Sommer. Ein Eisspeicher dient als Wärme- und Kältequelle für eine Wärmepumpe. Dieser nutzt die Energie des Phasenwechsels von Wasser zu Eis. Mithilfe der Wärmepumpe wird dem Eisspeicher im Winter Wärme entzogen. Dieses Eis kann dann möglichst lange im Jahr für eine freie Gebäudekühlung genutzt werden. Photovoltaik dient der Erzeugung elektrischer Energie. Mit dem geplanten Klima- und Energiekonzept ist ein nahezu klimaneutrale Gebäudebetrieb möglich.
Zahlreiche Aspekte, die sich als vermeintlich unentbehrlich in die Gebäudetypologie die letzten Jahre eingeschlichen haben – sei es aufgrund der Normung oder aufgrund von Nutzeranforderungen – und damit zu einer Technisierung der Gebäude führten, wurden in dem Gebäude bewusst hinterfragt. Trotz der ökologischen Leichtbauweise aus Holz wurde auf eine klassische Klimatisierung verzichtet. Auf eine Einzelraumregelung wurde ebenso verzichtet, wie auf eine maximale Flexibilität hinsichtlich der Raumeinteilung, da dies die Funktion der natürlichen Lüftung einschränken würde.



Fazit
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte eine Elite die Überzeugung, dass sich Bauen und Architektur verändern muss. Es entstand die Idee des »Neuen Bauens«; eine Architektursprache, die die Moderne prägte. Die Bewegung gab es bereits vor der Weißenhofsiedlung, jedoch wurde die Weißenhofsiedlung – zusammen mit einigen anderen Gebäuden dieser Zeit – zu den einflussreichsten Vorbildern der aufkommenden modernen Architektur. Heute sind wir an einem Punkt angelangt, wo sich Architektur in Anbetracht der ökologischen und sozialen Herausforderungen wieder radikal ändern muss. Es braucht wieder eine »Neues Bauen« und wie zu Beginn des 20. Jahrhunderts sehen wir auch jetzt eine Bewegung, die einen neuen Zeitgeist prägt. Die IBA’27 wird diesen Zeitgeist manifestieren. Vielleicht wird die IBA’27 nicht den gleichen Einfluss entfalten, den die Weißenhofsiedlung vor 100 Jahren hatte, sie wird aber die gleiche Relevanz haben!

Thomas Auer ist Professor für Gebäudetechnologie und klimagerechtes Bauen an der TU München sowie Mitglied der Geschäftsleitung von Transsolar Energietechnik. Er arbeitet weltweit mit renommierten Architekturbüros an Projekten mit integralen Klimastrategien und hoher Energieeffizienz. Sein Forschungsschwerpunkt liegt auf der Dekarbonisierung des Gebäudesektors und der Klimaadaption. Auer lehrte u. a. an der Yale University, ist Mitglied der Akademie der Künste und außerordentliches Mitglied im BDA. Zudem ist er Mitglied des Kuratoriums der IBA’27.
[1] https://www.iea.org/news/growth-in-global-energy-demand-surged-in-2024-to-almost-twice-its-recent-average?campaign_id=54&emc=edit_clim_20250324&instance_id=150810&nl=climate-forward®i_id=45831074&segment_id=194260&user_id=61fec622d67b7addeb984990f3390e55
[2] Bauherrschaft S111 GmbH, Fertigstellung 2025, Architektur RIEHLE KOETH, Tragwerk Merz Kley, Haustechnik Transplan, Project Management CPM GmbH