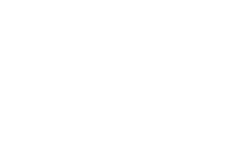Stimmen zur IBA’27
Burgfrieden oder Konfrontation
Für die IBA’27 ist die Baustil-Debatte kein Thema mehr – Der alte Streit zwischen Modernen und Traditionalisten schwelt jedoch weiter
von Klaus Jan Philipp
Die Architektenschaft Deutschlands lebt in einem kontinuierlichen Burgfrieden: Solange die Geschäfte gut laufen und alle etwas vom Kuchen abbekommen, lässt man sich in Ruhe. Nur manchmal schlägt man sich die Köpfe ein, attackiert unterhalb der Gürtellinie, wird gar bösartig. So geschehen zuletzt bei der Berufung Petra Kahlfeldts zur Berliner Senatsbaudirektorin. Manch eine:r wird bestimmt nicht mehr daran erinnert werden wollen, was sie oder er damals in der Presse über Frau Kahlfeldt auskotzte. Man wollte ja nur den Untergang der Welt verhindern, wenn jetzt die Reichen eine Architektur zweifelhafter Ästhetik ohne ökologische und soziale Komponente überall durchsetzen würden.
Je komplizierter die Welt wird, desto mehr wünscht man sich Eindeutigkeit: entweder Schwarz oder Weiß – kein Grau! Auf der einen Seite die ökologisch-sozialen Architekt:innen, die wie das Kaninchen vor der Schlange auf die CO2-Bilanz ihrer Holzhäuser starren. Auf der anderen Seite die Betonköpfe, die sich nicht mit Abrissmoratorien und Umbauordnungen belasten wollen. Solche Antagonismen kennen wir auch aus der Geschichte der modernen Architektur. Tatsächlich schien damals alles viel einfacher: Es gab die Modernen, die die Weissenhofsiedlung bauten, und die Traditionalisten, die die Kochenhofsiedlung bauten. Hier moderne Materialien und Konstruktionen sowie eine kubische Formensprache, dort Holzbau, Steildächer und traditioneller Städtebau.
»Je komplizierter die Welt wird, desto mehr wünscht man sich Eindeutigkeit.«
Klaus Jan Philipp
Schon 1924 hatten einige Berliner Architekten proklamiert, »neu entdeckte Gesetze des Gestaltens« gefunden zu haben und sich in der Vereinigung »Der Ring« zusammengeschlossen. Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe waren Mitglieder. Eine Konfrontation mit den eher konservativen Architekten suchte man jedoch nicht. Erst mit den Vorbereitungen zur Werkbundausstellung »Die Wohnung« und der Weissenhofsiedlung kam es zum offenen Schlagabtausch. Nachdem Mies van der Rohe die Stuttgarter Architekten Bonatz und Schmitthenner nicht zur Mitwirkung an der Ausstellung eingeladen hatte, setzten sich diese in der Stuttgarter Presse polemisch mit den Entwürfen Mies van der Rohes auseinander.
Ein Jahr nach der Stuttgarter Ausstellung wurde im Juli 1928 der »Block« als Gegenposition zum sich über Berlin hinaus erweiternden Ring gegründet. Die Gruppen dividierten sich weiter auseinander. Allerdings auch nur für eine überschaubare Zeit, dann kehrte auch in Stuttgart wieder Burgfrieden ein. Die Mitglieder des Blocks warteten nur darauf, dass die Siedlung nicht die in sie gesteckten Erwartungen erfüllte. Mit der Machtübernahme durch die Nazis erledigten sich allerdings solche Grabenkämpfe durch die »Gleichschaltung« aller Architekten.
Die Geschichte der Moderne ist jedoch nicht von solchem Schwarz-Weiß-Denken geprägt, wie sie Ring und Block verkörperten. Dazu ein Blick auf die Stuttgarter Bauausstellung von 1924, also drei Jahre vor der Werkbundausstellung 1927. Die Ausstellung wurde auf dem damals frei gewordenen Gleisbett des alten Bahnhofs – der heutigen Lauterschlagerstraße – ausgerichtet. Für die Ausstellungshallen entwarf der Stuttgarter Architekt Hugo Keuerleber eine expressionistische Architektur, die sich frech und bunt dem heroischen Bau des neuen Bahnhofs von Bonatz und Scholer entgegenstellte. In der Ausstellung waren innovative Baumaterialien und Konstruktionen zu sehen sowie konventionelle Einfamilienhäuser mit Steildächern.
In einer Sonderschau wurden Architekturzeichnungen aus dem Bauhaus zusammen mit solchen der Stuttgarter Schule präsentiert. Aus dem Bauhaus hatte Walter Gropius die modernsten Entwürfe zusammengestellt, darunter das Haus am Horn in Weimar oder den Entwurf für die Chicago Tribune. Leider wissen wir nicht, was die Stuttgarter Architekten ausstellten. Wahrscheinlich aber auch einen Querschnitt von Entwürfen und realisierten Bauten aus den Jahren nach 1918, nachdem Bonatz Paul Schmitthenner an die Stuttgarter Hochschule berufen hatte – also Siedlungsprojekte, Einfamilienhäuser und Verwaltungsbauten. Wie in der Ausstellung »Die Form ohne Ornament« des Werkbundes, die gleichzeitig mit der Bauausstellung in Stuttgart im Kronprinzenpalais gezeigt wurde, standen die »modernen« Projekte und Objekte des Bauhauses neben denjenigen der eher konservativen Stuttgarter. Es war also in Stuttgart 1924 das ganze Spektrum an Architektur und Gestaltung der 1920er Jahre friedlich versammelt.
»Die Geschichte der Moderne ist nicht von solchem Schwarz-Weiß Denken geprägt.«
Klaus Jan Philipp
In diesem anything goes, in dem jede:r seine Individualität ausspielen darf, finden wir uns gerne ein und halten den Burgfrieden. Hin und wieder aber knallt es, und es verfestigen sich die Fronten zwischen Modernen und Traditionalisten, so wie in den späten 1920er-Jahren und dann wieder während des Wiederaufbaus nach 1945. Später zwischen den »klassischen« Modernen und den Beton-Brutalisten, dann zwischen diesen und den Postmodernen in den 1980er Jahren. Schließlich der Kampf zwischen den Egomanen mit ihren signature buildings und denen, die zuerst an das urbane Umfeld denken und dann an das Haus.
Und heute im Vorfeld der IBA’27 StadtRegion Stuttgart? Über Form oder Ästhetik wird fast gar nicht mehr gesprochen, stattdessen über Ökologie, Resilienz und Robustheit, urbane Minen, nachhaltige Materialien, zirkuläres Bauen, Reparierbarkeit und über die soziale Stadt. Architektur im Zeitalter der Klimakrise hat offensichtlich andere Sorgen als Gestaltung. Dass die IBA’27 ein Schönheitswettbewerb werden wird, hat niemand erwartet und stand nie auf der Agenda. Dass die Projekte aber dennoch auch ästhetisch überzeugen und gefallen wollen, ist gleichwohl selbstverständlich. Zwischen begrünten Hightech Fassaden und dem einfachen Bauen aus Holz, Lehm, Stroh kündigt sich dabei neues Streitpotenzial an, das den Burgfrieden mal wieder stören könnte.
Über den Autor
Klaus Jan Philipp studierte Kunstgeschichte, Geschichte und Klassische Archäologie in Marburg und Berlin. 1985 Promotion, 1996 Habilitation. 2003 Professor für Baugeschichte an der Hochschule für bildende Künste Hamburg und an der HafenCity Universität Hamburg. Seit 2008 Leiter des Instituts für Architekturgeschichte der Universität Stuttgart. 2014 bis 2018 Dekan der Fakultät Architektur und Stadtplanung der Universität Stuttgart. Zahlreiche Publikationen zur Architekturgeschichte des Mittelalters, zum Klassizismus und 20.Jahrhundert; zuletzt »Architektur – gezeichnet. Vom Mittelalter bis heute« (Berlin Basel Boston: Birkhäuser 2020).
Dieser Beitrag ist erschienen in unserem Reader »Stimmen zur Internationalen Bauausstellung StadtRegion Stuttgart«.