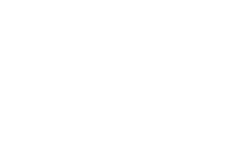Beitrag aus dem IBA’27-Kuratorium
Urbane Produktion in London. Ein kleines »Comeback« und viele Hindernisse
von Johannes Novy
Die Begriffe »produktive Stadt« und »urbane Produktion« sind in den letzten Jahren zu beliebten Schlagwörtern geworden. Jahrzehntelang beherrschten der Niedergang des verarbeitenden Gewerbes und die Umwandlung zentraler städtischer Räume in reine Dienstleistungs- und Konsumzentren die Diskussion über die Städte und ihre Zukunft. Und jahrzehntelang war es in der Stadtentwicklung vielerorts üblich, dem produzierenden Gewerbe einen eher untergeordneten Stellenwert einzuräumen, Betriebe als unerwünscht und unvereinbar mit anderen Nutzungen zu betrachten und sie zugunsten anderer Nutzungen aus den bestehenden Vierteln in speziell ausgewiesene Gewerbegebiete, meist am Stadtrand, zu verdrängen.
Dies beginnt sich nun zu ändern, denn nicht nur in der Region Stuttgart, sondern in ganz Europa und darüber hinaus wird zunehmend darüber diskutiert, wie das produzierende Gewerbe in den Städten gestärkt und seine Präsenz in gemischten städtischen Quartieren erhöht werden kann. Dies verdeutlicht beispielsweise die im November 2020 verabschiedete Neue Leipzig Charta, die die Idee der »produktiven Stadt« als Maßstab für eine moderne europäische Stadtentwicklungspolitik hervorhebt. Sie betont dabei ausdrücklich, dass sozial gerechte, ökologisch nachhaltige und wirtschaftlich robuste Städte Quartiere brauchen, in denen nicht nur Wohnen, Büros, Gastgewerbe, Freizeit und Einzelhandel nebeneinander existieren – und voneinander profitieren – können, sondern in denen auch wieder materielle Produktion stattfinden kann, das heißt Dinge hergestellt werden. Und auch auf kommunaler und regionaler Ebene, das belegen zahlreiche Projekte, wird der Bedeutung und dem Potenzial der lokalen Produktion heute deutlich mehr Aufmerksamkeit geschenkt als noch vor einigen Jahren. Rotterdams Makers District oder Newarks Makerhoods sind hierfür nur zwei Beispiele unter vielen. Zu diesem Trend dürfte auch die Forschung beigetragen haben, denn in den letzten Jahren gab es mehrere Veröffentlichungen und Forschungsprojekte, in denen argumentiert wurde, dass die städtische Produktion einen zweiten Blick verdient und ihre Vorteile herausgestellt wurden.
Urbane Produktion bereichert die Stadt
Die Präsenz des produzierenden Gewerbes ist Grundvoraussetzung, um dem Ideal einer wirklich funktional gemischten Stadt näher zu kommen. Sie kann dazu beitragen, Wertschöpfungsketten und städtische Räume nachhaltiger zu gestalten, städtische Ökonomien widerstandsfähiger zu machen und Industriebrachen und Stadtviertel neu zu beleben. Auch in sozialer Hinsicht spricht viel für »urbane Produktion«: So bieten produzierende Unternehmen zum einen oft vergleichsweise sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze und ermöglichen auch Arbeitnehmer:innen mit niedrigem Bildungsniveau berufliche Aufstiegschancen. Und zum anderen geht die Forschung davon aus, dass ihre Präsenz dazu beitragen kann, die soziale Mischung in den Stadtvierteln zu stärken, neue Formen des Miteinanders zu schaffen und Segregations- und Polarisierungstendenzen entgegenzuwirken. Und es gibt noch einen anderen Aspekt, der eine wichtige Rolle spielt: In der Vergangenheit wurden Stadtteile mit einem hohen Anteil an produzierendem Gewerbe als nicht attraktiv wahrgenommen – sei es wegen tatsächlicher Beeinträchtigungen wie Lärm- oder Geruchsbelästigung, oder einfach aufgrund der Vorstellung, dass die Industrie ein aussterbender Sektor sei und die Zukunft den Dienstleistungen gehöre.

Während also lange Zeit die Meinung vorherrschte, dass produzierende Unternehmen der Attraktivität und Lebensqualität städtischer Räume eher schaden als nützen, gewinnt nunmehr eine andere Sichtweise an Boden. Natürlich gibt es immer noch viele Branchen und Unternehmen, die nicht ohne Weiteres in städtische Kontexte integriert werden können – und die aufgrund ihrer spezifischen Standortanforderungen auch gar nicht in diese integriert werden wollen. Vielerorts wächst jedoch die Erkenntnis, dass immer mehr von ihnen, auch aufgrund emissionsärmerer Fertigungs- und Transportmethoden, nicht nur mit anderen Nutzungen vereinbar sind, das heißt ein Nebeneinander von Wohnen, Freizeit, Arbeit und Produktion möglich ist, sondern dass der daraus resultierende »urbane Mix« Stadträume attraktiver machen und eine wichtige unterstützende Rolle für die städtische Wirtschaft insgesamt spielen kann. Vielerorts sorgt eine neue Generation kreativer »urbaner Macher:innen« und wissensintensiver Tech-Betriebe für ein besseres Image des produzierenden Gewerbes und neue Impulse für die städtische Wirtschaft. Und es wächst die Erkenntnis, dass auch viele andere Branchen von produzierenden Unternehmen abhängen oder zumindest von ihrer Präsenz profitieren und dass urbane Produktion, vor allem wenn sie Produktionsprozesse sichtbar und erfahrbar macht, auch touristisches Potenzial birgt.
Hippe Manufakturen verdrängen die Industrie
Das ist zum Beispiel in London der Fall. In der britischen Hauptstadt, die wie kaum eine andere Stadt mit dem Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Verbindung gebracht wird, sind in den vergangenen Jahren in vielen Gegenden, wie zum Beispiel im traditionell industriellen Osten der Stadt, zahlreiche neue Unternehmen entstanden, die zum Teil eine erhebliche Dynamik entfalten. Sie produzieren Lebensmittel, Kleidung, Schmuck, Möbel, Haushaltswaren und Designobjekte und profitieren unter anderem von der wachsenden Nachfrage vor allem urbaner Milieus nach hochwertigen und individuellen Produkten, die nachhaltig und möglichst lokal hergestellt wurden. Viele von ihnen sind nicht nur in ganz London bekannt, sondern werden auch in Reiseführern und Reiseblogs beworben und verkaufen an Kunden weltweit. Die Maker Mile zum Beispiel, ein Kreativcluster in den Stadtbezirken Hackney und Tower Hamlets mit mehreren Dutzend Manufakturen, Ateliers und Werkstätten, ist längst zu einer eigenen Marke geworden und wird inzwischen auch im Stadtmarketing und von Akteuren der Immobilienbranche als solche genutzt.
Ähnlich verhält es sich mit den weiter stadtauswärts gelegenen, an das Londoner Olympiagelände angrenzenden Stadtvierteln Hackney Wick und Fish Island. Mit ihren verlassenen Industriegebäuden, Abbruchhäusern und Schrottplätzen galten sie lange Zeit als heruntergekommen. Heute sind sie schick und das auch wegen ihres spannenden Nutzungsmixes, der die Leichtindustrie einschließt und sie von anderen Stadtteilen abhebt. Im Prinzip wäre daran nichts auszusetzen, wären da nicht die bekannten Probleme, die mit der Aufwertung und Vermarktung städtischer Flächen verbunden sind: steigende Bodenpreise, verschärfter Wettbewerb um Flächen und daraus resultierende Verdrängungsdynamiken.

Schon aus diesem Grund ist London nicht nur ein inspirierendes, sondern auch ein warnendes Beispiel, denn bislang ist es Londons Politik nicht gelungen, die voranschreitende Verdrängung des produzierenden Gewerbes in den Griff zu bekommen. Obwohl allerorten neue Manufakturen, Maker Spaces oder Fab Labs entstehen, kann man in London, Stand jetzt, von einer »Renaissance« der urbanen Produktion nicht sprechen. Ein Kernproblem ist, dass das Angebot an erschwinglichen und bedarfsgerechten Flächen immer weiter abnimmt. Laut einem Bericht des Centre for London hat London allein in den letzten 20 Jahren fast ein Viertel seiner Industrieflächen verloren. Das hat zur Folge, dass es vor allem für kleinere Unternehmen, die in weniger prestigeträchtigen oder rentableren Sektoren tätig sind oder deren Flächenbedarf hoch ist, immer schwieriger wird, im Wettbewerb zu bestehen, was auch erklärt, warum der Anteil des produzierenden Gewerbes an der Bruttowertschöpfung und der Gesamtbeschäftigung in London bis heute auf einem niedrigen Niveau verharrt.
Keine Strategie gegen den Flächenmangel
In London mangelt es nicht an innovativen und kreativen Initiativen. Man denke nur an die Projekte des Architekturkollektivs Assemble wie das im Selbstbau errichtete Werkstatt- und Ateliergebäude Yardhouse im Stadtteil Stratford oder den Blackhorse Workshop in Walthamstow, ein Sozialbetrieb, der Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsräume für verschiedene Gewerke sowie Schulungsangebote anbietet. An Containerville, einer »Stadt in der Stadt« aus Dutzenden von Schiffscontainern im Herzen der Maker Mile, in der auch einige Start-Up-Manufakturen ein Zuhause gefunden haben. Oder auch Bauvorhaben wie 415 Wick Lane oder große Stadtentwicklungsprojekte wie das sechs Milliarden Pfund teure Meridian Water Projekt in Enfield im Nordosten Londons, bei denen das produzierende Gewerbe wieder Teil des Mixes ist. Im Rahmen des ambitionierten und keinesfalls unumstrittenen Projekts, das die Schaffung von 10.000 Wohnungen und 6.000 Arbeitsplätzen vorsieht, wurde vor kurzem Großbritanniens erste Open Access Factory eingeweiht, die in einer umgebauten Lagerhalle 32.000 Square Feet Arbeitsfläche und Equipment im Wert von 1,3 Millionen Pfund für eine breite Palette von Gewerken anbietet.

Es gibt jedoch weder ein stadtweites Konzept, wie wieder in größerem Maßstab produziert werden kann, und wie zum Beispiel auch flächenintensivere Betriebe und weniger repräsentative Teile industrieller Produktion stärker in das Stadtgefüge integriert werden können. Noch gibt es eine stadtweite Strategie, wie die mit Produktion verbundenen ökologischen und sozialen Potenziale besser genutzt werden können, zum Beispiel im Hinblick auf Klimaschutzziele, den Übergang zu einem ökologisch nachhaltigen Kreislaufwirtschaftssystem und einer gerechteren wirtschaftlichen Entwicklung. Daran hat auch der mit Spannung erwartete neue London Plan, der Anfang 2021 in Kraft getreten ist, nicht viel geändert. Die Neuauflage des strategischen Entwicklungskonzepts für Greater London zielt zwar darauf ab, den weiteren Verlust von Industrieflächen einzudämmen, und enthält auch einige Ideen zur besseren Nutzung und Durchmischung bestehender Industrie- und Gewerbegebiete. Das ursprüngliche Ziel, einen weiteren »Nettoverlust« von Industrieflächen auszuschließen, wurde jedoch nach einer Intervention des zuständigen Ministers auf nationaler Ebene fallen gelassen, und zu anderen Aspekten wie der besseren Förderung der städtischen Produktion außerhalb ausgewiesener Industriegebiete schweigt sich der Plan weitgehend aus.
Flächenkonkurrenz durch Wohnungsbau
Der Mangel an geeigneten Flächen, der bestehende Unternehmen bedroht und einem Wiedererstarken der lokalen Produktion in größerem Umfang im Wege steht, hat viele Ursachen, ist aber auch auf Londons anhaltende Wohnungskrise zurückzuführen. In der Vergangenheit führte sie dazu, dass Londons Stadtbezirke oft selbst dann bestehende Industriestandorte für neue Wohnungen freigaben, wenn ihnen der Schutz und die Förderung des produzierenden Gewerbes ein Anliegen war. Institutionell und finanziell geschwächt durch jahrelange Austeritätsmaßnahmen und aufeinanderfolgende Reformen, die ihre Handlungsspielräume immer weiter eingeschränkt haben, ist es für viele von ihnen bereits eine außerordentliche Herausforderung, die ihnen vorgegebenen Wohnungsbauziele zu erreichen und Bauträgern zumindest etwas bezahlbaren Wohnraum oder Zuschüsse für wichtige Infrastrukturinvestitionen abzuringen. Dass lokale Entscheidungsträger:innen vor diesem Hintergrund andere Ziele zurückstellen und mitunter wenig Spielraum sehen, um zum Beispiel bestehende Betriebe zu schützen oder gar Flächen für Neuansiedlungen durchzusetzen, ist zwar bedauerlich, aber nicht wirklich überraschend.
Dies verdeutlicht eine Problematik, die auch für andere Kontexte gilt, unter anderem für die Region Stuttgart: Um neue Wege zu beschreiten und die urbane Produktion stärker in den Fokus der Planung zu rücken, sie zu fördern und Instrumente und Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, die sie wieder stärker in das Stadtgefüge integrieren, bedarf es eines entsprechenden Willens seitens lokaler Entscheidungsträger:innen, aber nicht nur. Vieles hängt auch von den politischen Rahmenbedingungen ab, innerhalb derer diese operieren, und diese sind in London, Stand heute, gelinde gesagt schwierig.
Produktive Stadt darf nicht zum »Projekt von Eliten für Eliten« werden
Außerdem – und auch das ist für andere Kontexte wie das Programmgebiet der IBA’27 wichtig – zeigt das Beispiel London, dass viele der Potenziale, die gemeinhin mit urbaner Produktion verbunden werden, keinesfalls zwangsläufig eintreten. Was zum Beispiel die positiven sozialen Effekte betrifft, die der städtischen Produktion zugeschrieben werden, wäre es naiv anzunehmen, dass sie automatisch eintreten, oder zu verkennen, dass Neuansiedlungen auch problematische Auswirkungen nach sich ziehen können. Dies gilt insbesondere dann, wenn sie in benachteiligten Gebieten stattfinden, sich aber in erster Linie an zahlungskräftige Kund:innen richten. Viele Gegenden im Osten Londons zum Beispiel gehören auch heute noch zu den ärmsten Großbritanniens – und das, obwohl sie seit Jahren, manchmal sogar Jahrzehnten, Gentrifizierungsprozessen ausgesetzt sind. Deshalb ist es nicht überraschend, dass gerade Unternehmen, die überwiegend hochpreisige (Luxus-) Güter herstellen, die für die meisten Menschen vor Ort schlicht unerschwinglich sind, nicht immer mit offenen Armen empfangen werden. Vor allem dann nicht, wenn sie, wie es oft der Fall ist, mit öffentlichem Lob für ihre vermeintliche Kreativität, ihren Pioniergeist und ihren Beitrag zur lokalen Wirtschaft überhäuft werden, während traditionellere, aber weniger trendige Unternehmen, von denen viele von Migrant:innen betrieben werden, diese Anerkennung nicht zuteil wird.

Was das Beispiel London uns zeigt, ist, dass es wichtig ist, sich zu fragen, welche Art von Produzent:innen und Produkten gemeint sind, wer politisch geschätzt und unterstützt wird und wer nicht, wenn heutzutage von einer Renaissance der »produktiven Stadt« gesprochen wird. Denn bisweilen wird nicht gebührend berücksichtigt, dass auch andere produzierende Betriebe auf urbane Standorte angewiesen und für das Leben und die Wirtschaft in Städten unverzichtbar sind als jene der »stadtaffinen« Tech- und Maker-Szene, die den aktuellen Diskurs bestimmen. Als »Projekt von Eliten für Eliten« – so viel steht fest – werden sich viele der Potenziale, die der Idee der »produktiven Stadt« zugeschrieben werden, nicht realisieren lassen. Sie muss alle produzierenden Unternehmen im Blick haben und allen Stadtbewohner:innen Möglichkeiten eröffnen, nach ihren Fähigkeiten und Vorstellungen »produktiv« zu sein.
Literaturhinweise
Bathen, A. et al. (2019): Handbuch urbane Produktion: Potenziale. Wege. Maßnahmen. Urbane Produktion Ruhr.
Davis, Howard. 2020. Working Cities: Architecture, Place and Production. London; New York: Routledge.
Dellot, B., et al. (2018). Cities of Making – Cities Report. Abrufbar unter http://citiesofmaking.com/wp-content/uploads/2018/05/CoM_CityReport-0523-HR.pd
Lane, R. N., & Rappaport, N. (Eds.). (2020). The design of urban manufacturing. Routledge.
Über den Autor
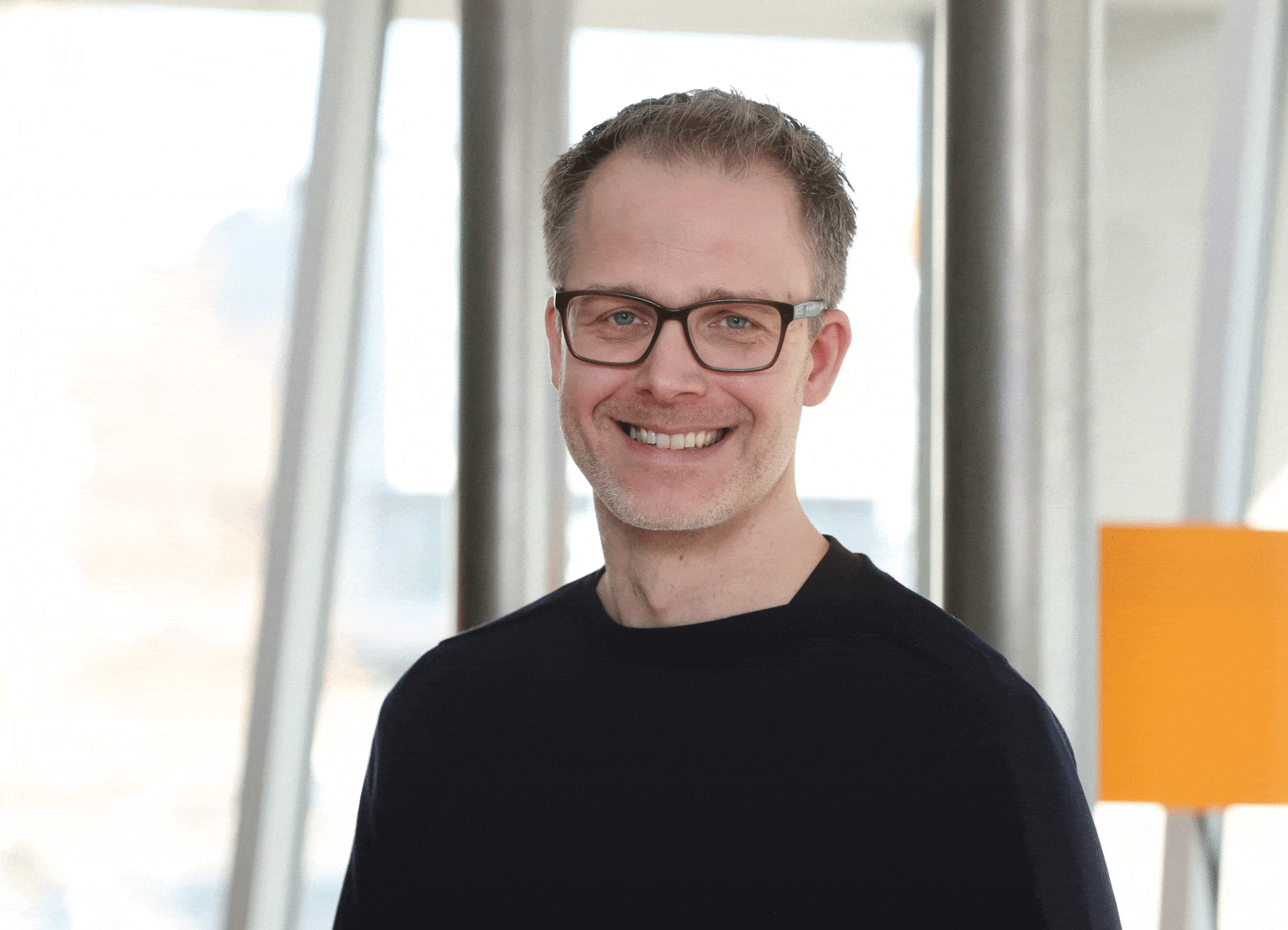
Dr. Johannes Novy ist Mitglied im IBA’27-Kuratorium. Novy ist Stadtplaner und Forscher und lehrt derzeit als Senior Lecturer an der University of Westminster in London. Seine Forschungsinteressen umfassen Stadt- und Planungstheorie, Stadt- (Entwicklungs-) Politik, Städtetourismus und Freizeitkonsum. Weitere Infos