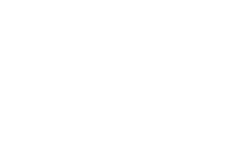Beitrag aus dem IBA’27-Kuratorium
Gelegenheiten, Konflikte und andere Bauelemente
Ein essayistischer Blick auf die IBA’27
von Heidi Pretterhofer
Die IBA’27 tritt an, um nichts Geringeres zu hinterlassen als… Unsicherheit. Und das ist gut so. Zwei Jahre vor dem eigentlichen Ausstellungsjahr zeichnet sich bereits ab: diese Internationale Bauausstellung wird nicht nur Gebäude hinterlassen. Sie hinterfragt, wie wir planen, wer dabei spricht, wer gehört wird – und wer nicht. Sie testet neue Allianzen, neue Werkzeuge, neue Perspektiven. Es geht nicht um »das Machbare«, sondern um das Notwendige – auch wenn letzteres oft das Unmögliche bedeutet.
Über das Unplanbare im Planen und produktive Unsicherheit
In den letzten Jahren hat sich die Welt mehrfach selbst überholt. Der Klimawandel ist nicht mehr Prognose, sondern Realität. Die sozialen Spaltungen in unseren Städten treten schärfer zutage, während demokratische Entscheidungsprozesse zäh und oft unverständlich bleiben. Vor diesem Hintergrund wird offensichtlich: Die Zukunft des Bauens ist sowohl eine architektonische als auch eine kulturelle, gesellschaftliche und politische Aufgabe. Die IBA’27 bewegt sich inmitten dieser tektonischen Verschiebungen. Ihre Projekte sind, Versuchsanordnungen die untersuchen, ob und wie eine andere Planung möglich ist – eine Planung, die nicht nur verwaltet, sondern gestaltet. Eine, die den gesellschaftlichen Aushandlungsprozess nicht als Störung, sondern als Ressource begreift.
Sowohl Stadtentwicklung als auch Quartiers- und Architekturplanung sind kollektive Baustelle – voller Friktionen, Interessenskonflikte und Machtverschiebungen. Wer sitzt am Tisch? Wer bleibt draußen? Wer entscheidet? Und wer trägt die Konsequenzen? Der klassische Planungsbegriff versagt oft an diesen Fragen. Nutzer:innen gelten als potenziell störend. Nachbar:innen als potenziell ablehnend. Und Politik und Verwaltung sind oft überfordert mit der Moderation wachsender Interessensgegensätze. Aber: Genau in diesen Reibungen liegt das Potenzial. Baukultur – verstanden als kollektives Projekt – beginnt dort, wo das Zusammenspiel unterschiedlichster Akteur:innen sichtbar und verhandelbar wird.
Zwischen Schönheit, Wahrheit und Profit
Die Stadtregion Stuttgart ist kein harmonisches Ganzes. Sie ist ein Aushandlungsraum zwischen Systemen, die selten miteinander sprechen: Politik, Wirtschaft, Recht, Ästhetik, Wissenschaft. Ihre Logiken sind nicht kompatibel – Profit kennt keine Gerechtigkeit, Wahrheit keinen Marktwert, Schönheit keine Gesetzeslage. Trotzdem – oder gerade deshalb – müssen sie miteinander in Beziehung treten. Nicht über einfache Kompromisse, sondern über »strukturelle Koppelungen«, wie Bruno Latour es nannte: Zwischenräume, in denen Neues entstehen kann und scheinbar inkompatible Systeme in Resonanz treten können. Die IBA’27 versucht genau solche Räume zu schaffen. Nicht als Lösungsmaschine, sondern als Plattform für das produktive Nebeneinander divergierender Rationalitäten.
Einige IBA-Projekte zeigen, wie das gelingen kann: kooperative Genossenschaftsmodelle, partizipative Quartiersentwicklungen, Planungsprozesse mit lernender Verwaltung. Sie alle basieren auf einem Verständnis von Baukultur, das zwar im gebauten Ergebnis kulminiert, aber im Prozess wurzelt – in Interaktionen, in Konflikten, im kollektiven Lernen. Anders gesagt: Es geht um das perfekte Haus, und um die richtige Frage. Nicht um das eine richtige Verfahren, sondern um die Fähigkeit, mit Unwägbarkeiten produktiv umzugehen. Diese Form des »anderen Bauens« ist unbequem. Sie verlangt Zeit, Vertrauen und Mut zur Unschärfe. Aber sie öffnet Perspektiven, die im klassischen Planungskanon nicht vorgesehen sind.
Romeo, Julia und die Genoss:innen vom Rotweg
Ein bemerkenswertes Beispiel innerhalb der IBA’27 für diese Form der Planungspraxis ist das Projekt »Das genossenschaftliche Quartier am Rotweg« in Stuttgart-Rot. Die Baugenossenschaften Neues Heim und Zuffenhausen realisieren hier gemeinsam mit zukünftigen Bewohner:innen, Planungsteams und der IBA ein Quartier, das vielfältige Wohnformen, soziale Durchmischung und ökologische Standards verbindet. Partizipative Methoden – wie eine Laborbühne oder ein maßstabsgetreues 1:1-Modell – fungieren nicht nur als Visualisierungswerkzeuge, sondern als Orte der Aushandlung. Planen wird hier zur Übersetzungsarbeit – zwischen Wünschen, Wirklichkeiten und Widersprüchen. Unterschiedliche Interessen werden nicht nivelliert, sondern als wertvolle Beiträge anerkannt, mit dem Ziel, ein zukunftsfähiges Quartier zu schaffen, das die soziale, ökologische und gestalterische Vielfalt nicht nur verhandelt, sondern sichtbar und erlebbar macht – in Architektur und Raum.

Quartier am Rotweg. Architektur: ISSS research | architecture | urbanism, topo*grafik paysagistes, StudioVlayStreeruwitz, EMT Architekten, Greenbox Landschaftsarchitekten. (Bild: Heidi Pretterhofer)
Dieser Ansatz steht für eine agonistische Planungskultur: nicht konfliktvermeidend, sondern konfliktnutzend! Die Politikwissenschaftlerin Chantal Mouffe spricht in diesem Zusammenhang von agonistischer Demokratie [1] – einer Demokratie, die Konflikt nicht als Defekt, sondern als Dynamik versteht. Planen, so verstanden, ist kein Konsensspiel. Es ist ein demokratischer Akt. Und genau deshalb braucht es neue Rollenbilder: Die Planer:in ist auch Moderator:in, die Verwaltung ist auch Lernende, die Nutzer:in ist auch Expert:in ihrer eigenen Lebensrealitäten.
Die heikle Mission im Quartier am Rotweg ist, dass es sich um einen »Wohnungstausch« im wörtlichen Sinn handelt, die Bestandsgebäude der Nachkriegssiedlung werden abgebrochen und ersetzt, ihr Allgemeinzustand sei zu schlecht, es sind namenlose mehrgeschossige Zeilenbauten der 1950er-Jahre.
Nur 5 Gehminuten entfernt steht das prominente, mittlerweile denkmalgeschützte Hochhauspaar »Rome und Julia«, ebenfalls in den 1950er geplant und gebaut (Architektur: Hans Scharoun und Wilhelm Frank). »Sie gelten als herausragende Zeugnisse der Nachkriegsmoderne. Mit dem Hochhausensemble schuf Scharoun einen Ort der Identifikation für die Siedlung Rot. Romeo, turmartig kompakt, und Julia, raumgreifend mit kreisförmigem Grundriss, kontrastieren einander.«[2] »Romeo und Julia« sind ein spannendes Beispiel für unbeabsichtigte Nachhaltigkeit, der Entwurf ist weit weg von funktionalistischen Rasterstrukturen der Nachkriegsmoderne. Der Raum ist dialogisch gedacht. Er reagiert auf Landschaft, Ausblick, Nachbarschaft und die Individualität der Bewohner:innen und wird dadurch langlebig und aktuell.
Das genossenschaftliche »Quartier am Rotweg« antwortet hingegen mit sozialer Innovation auf die gegenwärtigen Anforderungen: durch ko-produktive Planung sollen solidarische Eigentumsformen, Integration von Arbeit und Freizeit und ökologisch Bauweisen umgesetzt werden. Architektonisch gesehen strebt es eine neue Form von Dichte und Gemeinschaft an – mit Mitteln, die bewusst nicht spektakulär, sondern nachhaltig und integrativ gedacht sind. Der Außenraum spielt eine zentrale Rolle, er ist das Gerüst des gemeinschaftlichen Zusammenlebens und schafft eine durchlässige Choreografie zwischen dem Privaten, dem Halböffentlichen und dem Öffentlichen – ohne Zäune. Die Übergänge zwischen den Raumtypen sind sanft abgestuft. Das Quartier denkt Nachbarschaft nicht als Pflicht, sondern als Option – räumlich vorbereitet, atmosphärisch begünstigt. die architektonische Qualität des Projekts liegt sowohl in der Form, als auch im Prozess: in der Art, wie hier geplant, diskutiert, gestritten und gelernt wird – und wie all dies in gebaute Gestalt übersetzt wird.
Obwohl mehr als 60 Jahre zwischen »Romeo und Julia« und dem »Quartier am Rotweg« liegen, sind ihre Anliegen verwandt: sozial orientiertes, zukunftsfähiges Wohnen für die Stadtgesellschaft. Doch sie verkörpern verschiedene Paradigmen: »Romeo und Julia« als architektonische Vision einer besseren Gesellschaft, das Rotweg-Quartier als sozial-prozessuales Experiment einer gerechteren Stadt. Beide sind – auf ihre Weise – Modelle für gemeinschaftsorientiertes Wohnen jenseits von Standardisierung und Renditelogik.

Konflikt als Ressource
Die IBA’27 hat kein Interesse an glatten Bildern. Ihre Stärke liegt im Widerspruch, im Streit, im Experiment. Dort, wo die Zusammenarbeit stockt oder scheitert, zeigen sich die wahren Herausforderungen – und damit auch die Hebel für Veränderung. Konflikte müssen nicht aufgelöst, sondern verstanden und in produktive Bahnen gelenkt werden.
Gerade die vielstimmige Realität der Kommunen verlangt nach Prozessen, die diese Stimmen nicht nur zulassen, sondern aktiv einbinden. Die IBA kann hier als Labor dienen, als Übersetzerin zwischen den Welten – nicht im Sinne fertiger Lösungen, sondern als Plattform für gemeinsames Lernen.

Wer über Baukultur spricht, spricht über Machtverhältnisse. Wer entscheidet, was gebaut wird? Welche Interessen setzen sich durch? Und wessen Zukunft wird dabei (nicht) mitgedacht? Baukultur ist keine Zierde, kein ästhetisches Beiwerk. Sie ist der Ausdruck gesellschaftlicher Aushandlung – sichtbar in Material und Form, aber getragen von unsichtbaren Netzwerken: Geldströmen, Normen, Regeln, Beziehungen. Und genau deshalb ist sie niemals neutral. Sie ist immer ein politisches Statement, ob bewusst oder nicht.
Vom Objekt zur Beziehung und zurück
Vielleicht ist das die wichtigste Lehre der IBA’27: Der Fokus erweitert sich, nicht weg vom Objekt, sondern hin zur Beziehung, ohne das Gebaute aus dem Blick zu verlieren. Architektur als Beziehungsarbeit zwischen Menschen, Orten, Ideen, Systemen. Zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In dieser Perspektive liegt das utopische Potenzial: nicht als Rückgriff auf große Visionen, sondern als konkretes Erkunden neuer Möglichkeitsräume.
Oder wie Latour und Schultz es formulierten: »Nichts wird uns retten – ganz bestimmt nicht die Gefahr. Der Erfolg wird einzig von unseren Fähigkeiten abhängen, die zufällig sich einstellenden Gelegenheiten beim Schopf zu packen.«[3] Die IBA’27 kann ein solcher Moment sein – wenn wir sie als offene Baustelle begreifen: für neue Allianzen, für eine Planungskultur des Miteinanders, für eine Baukultur, die die Gesellschaft in ihrer Widersprüchlichkeit ernst nimmt.


Heidi Pretterhofer ist Architektin und leitet in Wien das Büro Pretterhofer Arquitectos. Ihre Arbeit bewegt sich zwischen Architektur, Urbanismus, Theorie und Kulturproduktion. Seit 2023 hat sie gemeinsam mit Michael Rieper die Professur für Baukultur an der Kunstuniversität Linz inne. Zudem ist sie Mitglied des Kuratoriums der IBA’27.
[1] Mouffe, C. (2014). Democratic Politics and Agonistic Pluralism. In S. Graham & P. Healey (Eds.), Contemporary Debates in Planning Theory (pp. 15–30). Routledge.
[2] https://www.stadtlexikon-stuttgart.de/dts/index.html?id=748bc4af-8772-4cf0-be20-1b1786e9764b
[3] Latour, B., & Schultz, N. (2022). Zur Entstehung einer ökologischen Klasse. Ein politischer Aufruf. Suhrkamp.