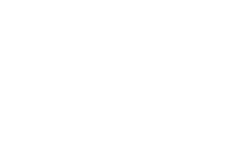Beitrag aus dem IBA’27-Kuratorium
Wo Gebautes und Umgebautes zusammen findet
Die IBA’27 als Impulsgeber für eine ökologisch verantwortete Baukultur in urbanen Landschaften
von Andreas Kipar
Stadt gegen Land. Hier urban ökonomische Verdichtung und zukunftsorientierte soziale Vernetzungen, dort landschaftlicher Freiraum und der Natur verpflichtete traditionelle Bindungen. Dieses Bild verschwimmt seit geraumer Zeit, seine klaren Konturen verblassen. Denn wie sich die Stadt ins Land weitet, dringt Natur in die Stadt. Wenn wir die Stadt als eine urbane Landschaft verstehen, lösen sich die Gegensätze zwischen städtischen und ländlichen Räumen auf. Dennoch hält man hierzulande an der Gegenüberstellung der Ansprüche von Naturschutz und Stadtplanung fest – trotz aller Anstrengungen verschiedener Seiten, diese aufzubrechen. Doch mit vielleicht hier und da modifizierten alten Modellen werden wir die Entwicklung in den Regionen nicht mehr steuern können. Wir brauchen neue Formate. Formate, wie sie etwa eine IBA entwickeln kann, die sich als Impulsgeber für die Zukunft versteht.
Lebensqualität lässt sich in urbanen Landschaften herstellen, wenn sie empathisch und nachhaltig mit Grün als Bindemittel gestaltet werden. Die Steigerung des Grünflächenfaktors gehört heute zu den Hausaufgaben jeder Kommunalverwaltung. Ein Rollenwechsel steht an: Der natürliche, der unbebaute Raum tritt als Stichwortgeber und gleichwertiger Hauptdarsteller neben den bebauten Raum auf die Bühne. Die Kompetenzen zwischen Bebautem und Unbebautem fließen in dem Maß zusammen, wie sich die Grenzen zwischen Stadt und Land auflösen und das Quartier gleichsam in die Region abfärbt, wie es sich von ihr bereichern lässt. Es sind die Städte und die urbanen, grenzübergreifenden Makroregionen, die in den Mittelpunkt der Klimaresilienz rücken: Die Stadt der Zukunft ist die Region.
Wasserläufe als ökologische Muskelstränge
Die Stadt Stuttgart kommt aus der Tradition der Vernetzung von Grünflächen im »Grünen U« und macht sich jetzt auf den Weg, regional neue Netze zu knüpfen. Die Diskussionen und Entwicklungen in Städten wie Paris oder Wien, Turin oder Düsseldorf zeigen, wie Flüsse als ökologische Korridore in die urbanen Räume hinein wirken und diese zugleich nach außen in die Region tragen. Etwa wie Stuttgart über den Neckar sein Umland entdeckt und es mit Wasserläufen als gleichsam ökologische Muskelstränge stärkt, wie es sich von ihm stärken lässt. Mit dem Wegfall von Produktionsstätten öffnen sich Frei- und damit Stadträume. Straßen mutieren von reinen Achsen für den schnellen Gütertransport zu hybriden Verkehrsverbindungen für Menschen und Fahrzeuge mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Bedürfnissen. Die Morphologie, das Flusstal, natürliche Begebenheiten rücken in den Vordergrund.
Deutlich wird: Allein über die Natur und ihre Freiräume können wir Stadträume als urbane Landschaften neu denken, die vom Menschen und seinen Bedürfnissen ausgehen. Urbane, grün implantierte Landschaften greifen die Klimaanpassung auf, nutzen Wasser produktiv, kühlen, schaffen Biodiversität. Diese ökosystemischen Dienstleistungen sind zudem messbar und können in Zukunftsplanung eingehen.
Von der Nature-positive City zur Nature-positive Landscape
Wenn sich aber die Grenzen zwischen Stadt und Land auflösen, müssen die ökologischen Verpflichtungen, die die Stadt zu übernehmen hat, für die Region, die Landschaft mitgedacht werden, zumal das Land (Verödung der Landwirtschaft, Absterben von Wäldern, Fehlen von Infrastrukturmaßnahmen) anfälliger ist. Solange wir ökosystemische Dienstleistungen (Barrieren abschleifen, Flächen schaffen, Bäume pflanzen, Böden aufreißen) nur punktuell konzentrieren und die »Nature-positive City« nicht auch als »Nature-positive Landscape« konzipieren, können wir hier und da vielleicht Schäden reparieren, aber nicht die Ursachen bekämpfen. Und umgekehrt bleiben auf die Landschaft bezogene Einzelmaßnahmen Flickarbeit. Stadt und Land: Alles ist Landschaft. Das IBA-Projekt in Fellbach (»Agriculture meets Manufacturing«) zeigt, wie sich eine neue Stadt aus einem alten Industriegebiet mit urbaner Landwirtschaft entwickelt.

Zur aktiven Förderung von nachhaltigem ökonomischen Wachstum und der natürlichen Gestaltung urbaner Räume ruft deshalb das »Nature-Factory Manifesto« auf, in dem sich zwei in ihren Feldern führende Akteure zusammen gefunden haben: Porsche Consulting, die Managementberatung der renommierten Automobilmarke, und mein internationales Beratungsunternehmen LAND für urbane und rurale Planungen. Das Manifest, das eine zukunftsweisende Vision für die Integration von Natur und Nachhaltigkeit in städtische und industrielle Landschaften skizziert, wurde Ende Januar in Davos auf dem World Economic Forum 2025 vorgestellt. Es richtet seinen Fokus »auf Städte und breite urbane Ökosysteme«, unterstreicht die »Förderung der urbanen Entwicklung durch Naturreichtum«, will »Unternehmen zu Agenten der Naturproduktion« machen, »öffentlich-private Partnerschaften für biologische Vielfalt, Nachhaltigkeit und die Wiederherstellung von Ökosystemen in der urbanen Entwicklung« fördern und »Messung der Fortschritte durch die Bilanzierung von Naturkapital« ermöglichen.
Konkrete Maßnahmen als Antwort auf die Klimakrise
Mit naturfreundlichen Strategien und Entscheidungen, die auf diesen Grundsätzen beruhen, können wir Städten, Unternehmen und Planern einen Leitfaden und Praxiswissen an die Hand geben, um der Klimakrise mit konkreten, messbaren Maßnahmen zu begegnen. Denn es zeichnet sich bereits ab, dass das Thema der ökosystemischen Dienstleistungen prägend für die Zeit nach der IBA’27 sein wird. Wie wir heute noch Energie aus den Nachwirkungen der IBA Emscher Park oder der IBA Fürst-Pückler-Land und der visionären Rolle ihrer Macher Karl Ganser (1937-2022) und Rolf Kuhn (1946-2024) schöpfen, geht es darum, die Einzelarchitekturen der IBA’27 energiegeladen nach vorne zu denken. Als Ausgangspunkt bietet sich der Grundgedanke der Weissenhofsiedlung und der Schaffung von neuen vielgestaltigen Lebensräumen an, in denen Gebautes und Ungebautes zusammenspielen.
Dadurch, dass wir mit Natur nachhaltig planen und Stadtlandschaften kultivieren, werden zukünftige Generationen wachsende Lebensqualität ernten können, denn Natur wächst zwar langsam, aber unermüdlich (wenn wir sie lassen). Spätestens seit der Pandemie öffnet sich auch Architektur dem Zeitgeist. Häuser, Parkhäuser, alte Depothäuser etc., die sich zur Stadt, zum urbanen Raum öffnen und neue Gebäude, die aus dem Ungebauten moderiert werden, lassen urbane Landschaften entstehen. Die Energie einer IBA kann und wird in ihrer Nachwirkung eine ökologisch verantwortete Baukultur stärken, die jene urbane Landschaften generiert, die die dringend benötigten ökosystemische Dienstleistungen liefern. Architektur und Natur, die lange eher misstrauisch nebeneinander gewirkt haben, finden so zu einem Miteinander.

Andreas Kipar, Landschaftsarchitekt & Urbanist, Geschäftsführender Gesellschafter des Beratungs- und Planungsunternehmen LAND mit Niederlassungen u. a. in Mailand, Düsseldorf, Lugano und Wien. Kuratoriumsmitglied der IBA’27 StadtRegion Stuttgart.